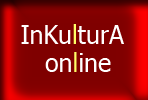Buchkritik -- Jhumpa Lahiri -- Das Wiedersehen
 „Das Wiedersehen“, oder wie der Untertitel heißt, „Römische Geschichten“ handelt weniger um Rom als vielmehr um Fremdheit. Da sein, aber nicht angekommen. Hier leben, aber fremd sein.
„Das Wiedersehen“, oder wie der Untertitel heißt, „Römische Geschichten“ handelt weniger um Rom als vielmehr um Fremdheit. Da sein, aber nicht angekommen. Hier leben, aber fremd sein.
Obwohl fast alle ihre Protagonisten in der Stadt leben, wurden nur wenige von ihnen dort geboren und Lahiri lässt die Leserinnen und Leser im Ungewissen über deren nationale Herkunft. Sie bevorzugt das vage „Ausländer“ gegenüber dem treffenderen „Einwanderer“ oder „Flüchtling“ und verwendet ersteres als Bindeglied zwischen vielen verschiedenen Formen des Fremdseins in und an einer Stadt.
In „Die Treppe“ wirft Lahiri einen ernüchternden Blick auf das moderne Rom mit einem sechsteiligen Porträt von Bewohnern, die regelmäßig eine Steintreppe mit 126 Stufen hinaufgehen, die zu einem Treffpunkt für Teenager geworden ist, die sich darauf niederlassen „wie Fliegen auf einem Stück Melone“, dort zerbrochene Flaschen und zerdrückte Zigarettenschachteln hinterlassen.
Die Stufen werden zu einer zweimal täglich zu bewältigenden Tortur für die hart arbeitende Frau, die an ihren 13-jährigen Sohn denkt, den sie bei seinen Großeltern auf einem anderen Kontinent zurückgelassen hat, während sie sich um zwei kleine Kinder und deren berufstätige Eltern kümmert.
Eine misstrauische Witwe, die sich weigert, ihre Lebensmittel „von einem Jungen aus einem anderen Land“ liefern zu lassen, findet die versammelte Jugend beängstigend.
Doch für eine amerikanische Frau, die sich hier einer Operation unterziehen muss, stehen die Stufen für all das, was sie in ihrem ehemaligen idyllischen, bewaldeten Haus außerhalb von New York vermisst, wo sie gehofft hatte, ihre drei Söhne großzuziehen.
Einige ihrer Figuren entscheiden sich für einen Aufenthalt in Rom, etwa ein Gelehrter, der sich „letztendlich mehr mit einem Ort als mit einer Person verheiratet fühlt“; andere fühlen sich dort gefangen. Manche sind durch Alter oder Unglück zu Fremden geworden, wie der romanhafte Erzähler von „Die Feste von P.“, einer Geschichte, die als melancholische Gesellschaftskomödie beginnt und sich in eine Meditation über den Tod verwandelt. Der Erzähler und seine Frau besuchen jedes Jahr dieselbe Party und schließen sich einer Gruppe wohlhabender Italiener und Expats an, deren wechselnde Dynamik den Protagonisten gleichermaßen fasziniert und entfremdet.
Die mit Abstand schmerzhafteste Geschichte ist „Helle Wohnung“, deren Erzähler vor Konflikten in seiner anonymen Heimat floh. In Rom heiratete er, das Ehepaar bekam fünf Kinder und dank des Staates fanden er und seine Frau ihr erstes dauerhaftes Zuhause in einem Vorort mit „freiem Himmel“. Zunächst sind sie von der Wohnung so verzaubert, dass „ein weißes Licht unsere Seelen durchfluten würde, während wir uns liebten“. Doch bald machten ihre italienischen Nachbarn ihre Bigotterie deutlich: „Jedes Mal, wenn wir das Haus verließen, beleidigten sie uns“, organisierten Proteste und hinderten die Familie daran, ihr eigenes Haus zu betreten, während sie riefen: „Packt eure Koffer.“ Schließlich flieht seine Frau, die den Schleier trägt, mit den Kindern aus Italien, und der Erzähler findet sich allein beim Verkauf von Büchern in einer dunklen Unterführung wieder, belastet von einer Isolation, die sich vollkommen anders darstellt, als die des Protagonisten in „Die Feste von P.“.
Lahiris Figuren werden häufig überfallen – sei es durch unerwartete Emotionen, wie der Ehemann, der in „Die Feste von P.“ von seinen ehebrecherischen Gefühlen überrascht wird, oder durch tatsächliche Angriffe, wie der Drehbuchautor, der spät in der Nacht auf den verlassenen Stufen von einer Gruppe Kinder überfallen wird, die ihm sein Bargeld und die Digitaluhr wegnehmen, die ihm seine junge zweite Frau zu seinem 60. Geburtstag geschenkt hat.
In „Die Postsendung“ fühlt sich eine vermutlich dunkelhäutige Haushälterin, die für ihre Patrona einen Botengang macht, in ihrem gepunkteten Rock ziemlich sicher – bis sie von zwei Jungen angegriffen wird, die ihr spöttisch zurufen: „Geh und wasch dir die schmutzigen Beine.“
Viele von Lahiris Figuren sind zwischen zwei Welten gefangen. Selbst die in Rom geborenen leiden unter einem Gefühl der Fremdheit. Sie alle bleiben namenlos und das hebt den Identitätsverlust hervor, der mit Umzug und Entfremdung einhergeht und deutet auf die Universalität solcher Situationen hin. Doch mit diesem Mangel an Konkretheit geht eine beunruhigende Ferne einher, zusammen mit einer vagen Unbestimmtheit.
In „Das Wiedersehen“, eine weitere Geschichte über Rassenvorurteile, werden die beiden namenlosen Frauen, die sich in einer Trattoria treffen, nur als „die Frau in Trauer“ und „die Professorin“ bezeichnet; Namen wären besser und, wenn sie gut gewählt wären, wirkungsvollere Identifikationszeichen gewesen.
In „Dante Alighieri“, der letzten römischen Erzählung, denkt eine in Amerika geborene Professorin der italienischen Literatur, die mit einem älteren italienischen Arzt verheiratet ist, über die drei sie immer noch belastenden Handlungen nach, die sie in ihrem Leben begangen hat: an ihrer besten Freundin im College, an ihrem Ehemann und schließlich der Verrat an ihren eigenen Wünschen und Zielen, die sie durch „falsche Tugend“ unterdrückte. Wir erfahren, wie sie sich nach und nach von ihrem Ehemann entfernte und nach Amerika zurückkehrte, um zu unterrichten, während sie eine Wohnung in Rom behielt. Während der Beerdigung ihrer geliebten Schwiegermutter denkt sie nach: „Man reist eine gewisse Strecke, man hat Wünsche und trifft Entscheidungen, und dann bleiben Erinnerungen zurück, manche schillernd, manche verstörend, die man lieber nicht heraufbeschwören möchte. Aber heute, in der Basilika, dominiert die Erinnerung, die tiefste Art. Sie wartet unter dem Felsen auf dich – Teile von dir selbst, noch lebendig und ruhelos, die erschauern, wenn du sie freilegst.“ Und sie fragt sich: „Wie lange müssen wir leben, um zu lernen, wie man überlebt?“
„Das Wiedersehen“ ist eine mit leisen Tönen orchestrierte Sammlung von Geschichten, die auf subtile Weise die Melancholie des Verlorenen und die innere Unbehaustheit thematisiert und sich durch ihre fein nuancierten Erzählungen auszeichnet.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 2. Juli 2024