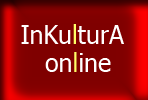Buchkritik -- T. C. Boyle -- I walk between the Raindrops
 Einmal mehr behauptet T.C. Boyle seinen Platz als Amerikas großer Schriftsteller der literarischen Fiktion, wobei er insbesondere seine Meisterschaft im Genre der Kurzgeschichte zeigt; und diese neueste Sammlung von 13 präzise gestalteten Ausschnitten aus dem Leben, vermischt mit gelegentlichen Ausflügen in seinen geliebten magischen Realismus, beweist, dass er immer noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist.
Einmal mehr behauptet T.C. Boyle seinen Platz als Amerikas großer Schriftsteller der literarischen Fiktion, wobei er insbesondere seine Meisterschaft im Genre der Kurzgeschichte zeigt; und diese neueste Sammlung von 13 präzise gestalteten Ausschnitten aus dem Leben, vermischt mit gelegentlichen Ausflügen in seinen geliebten magischen Realismus, beweist, dass er immer noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist.
Wieder einmal seziert er die Psyche seiner Charaktere so glaubhaft, dass man entweder Mitleid mit ihnen hat oder sie hasst. Da ist zum Beispiel „Die Form einer Träne“, in der die Erzähler eine Frau mittleren Alters und ihr 31-jähriger Sohn sind, der zu Hause lebt und das Schnorren zu einer Kunstform und Lebenseinstellung erhoben hat. Angewidert von seinem mangelnden Beitrag, seiner Weigerung, sein eigenes Kind, ihr einziges Enkelkind, anzuerkennen, sieht sie keine andere Möglichkeit, als ihn gerichtlich aus dem Haus werfen zu lassen. Hier beginnt der Spaß, denn er erwidert, es sei ihre Schuld, dass er überhaupt geboren wurde und deshalb gezwungen sei, die Härten des Lebens zu ertragen.
Beide Charaktere sind problematisch, eine Spezialität, die Boyle genüsslich beschreibt. Der Junge ist ein verwöhnter Millennial, so verwöhnt, egozentrisch und faul, dass man ihm am liebsten ins Gesicht schlagen würde, während die Mutter so völlig abhängig von anderen ist, dass man sie am liebsten in die Realität zurückholen würde, weil sie so ein leichtes Opfer ist. Die Erzählung wechselt zwischen Sohn und Mutter hin und her; wir sehen beide Seiten, die gleichwohl etwas bescheuert daherkommen.
Wie vorherzusehen war, wartet der Junge bis zur letzten Minute und zwingt die Bezirkspolizei, einen Polizisten zu schicken, um das Urteil durchzusetzen, bevor er widerwillig handelt, während er sich die ganze Zeit über die seiner Meinung nach unhöfliche und unfaire Behandlung ärgert, während die Mutter sich schlecht fühlt und eingreifen will, was ihr Mann jedoch nicht zulässt. Der Leser empfindet wenig Empathie für die beiden, da ihre Überzeugungen und ihr Verhalten dazu führen, dass jeder von ihnen erntet, was er gesät hat.
Wie immer ist Boyle auch in dieser Sammlung ein Meister der Ironie. In „Die Wohnung“, die in Frankreich spielt, schließt ein Mann, siebenundvierzig Jahre alt, einen Vertrag mit einer älteren Frau ab, eine monatliche Gebühr für ihre Wohnung zu zahlen, wenn sie zustimmt, dass sie im Falle ihres Todes in seinen Besitz übergeht. Der Mann merkt kaum, dass er gegen die dritte der drei Regeln des Immobiliengeschäfts verstößt, die da lauten: 1. Lage, 2. Bedingungen und 3. Warte nie, bis eine alte Dame stirbt. Die Vereinbarung, die die Frau im Alter von 90 Jahren traf, kommt nie zustande, denn sie wird 110 Jahre alt und dann, unglaublicherweise, 120 Jahre alt. Dumm gelaufen für Monsieur.
Daneben hat Boyle immer ein feines Gespür für aktuelle Reizthemen.
In „SKS 750“ ist ein Mann entschlossen, im Spiel des Lebens zu gewinnen, indem er seinen Social-Kredit-Score auf über 700 bringt. Dieses Streben danach führt dazu, dass er schließlich seinem besten Freund und einer jungen Frau, der er sehr gewogen ist, den Rücken kehrt, als er erkennt, dass ihn die Verbindung zu ihnen seinem Bestreben nach einem höheren Score, der viele Annehmlichkeiten mit sich bringt, im Weg steht. Schöne neue Welt.
In „Schlaf am Steuer“ nimmt sich Boyle des Themas „Smarte Dinge“ an, die, so praktisch sie auch scheinen, im Fall der Mutter die Sehnsucht nach emotionaler Authentizität wecken und, im Fall ihres Sohnes, zu einem tragischen Ereignis führen.
In „What’s Love Got to Do with It?“ nimmt eine Frau mittleren Alters, von der der Leser annehmen kann, dass sie attraktiv ist, weil sie eine wunderschöne Tochter hat, einen Amtrak-Zug von Los Angeles nach Dallas, um an einer Geschäftskonferenz teilzunehmen. Auf ihrer Reise trifft sie einen jungen Mann namens Eric, der nicht besonders gut aussieht, etwas ungepflegt ist, fast schon schlampig, und der einen riesigen Groll gegenüber hübschen Mädchen hegt, die ihm keine Beachtung schenken.
Im weiteren Verlauf der Geschichte erfahren wir, dass er mit einem Campus-Schützen namens E.R. befreundet war, der in eine gewisse Mary Ellen Stovall verliebt war, die so etwas wie die Campus-Königin war. Eric selbst beginnt, Stovall zu verfolgen, nachdem sie einen ungeschickten Annäherungsversuch von E.R. an sie kategorisch zurückgewiesen hat. Er rechtfertigt sich damit, dass er es nur tut, um zu sehen, wie sie ist, aber sie bemerkt, was er tut, und er zieht sich zurück.
Für E.R. wird die Demütigung, die er durch ihre Zurückweisung empfindet, zu Gewalt. Er schießt sechs Studenten nieder und verletzt 14 weitere, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtet. Eric und die Frau geraten argumentativ in eine Sackgasse, als er Verständnis für den Schützen zeigt.
Fazit: Das Leben ist, wie es ist und das Leben ist nicht fair, also sind die Vernünftigen gezwungen, die Karten auszuspielen, die ihnen zugeteilt werden. Ob das allen so gut gelingt, wie dem Ehepaar in „Valentinstag“, das unbeschadet von allen widrigen Umständen durch Leben geht, darf angezweifelt werden.
Schon eher dürfte, wie in „Der dreizehnte Tag“, als Passagiere und Besatzung eines Kreuzfahrtschiffes wegen des Ausbruchs von Corona an Bord in unfreiwillige Quarantäne gehen müssen, das Unglück immer dann zuschlagen, wenn man es am wenigsten erwartet.
T.C. Boyle und das wirkliche, harte Leben.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 20. Juli 2024